Ich bin ein Verfechter von Dialog.
Von Brücken statt Mauern.
Von versöhnlichem Dialog als Grundlage für ein gedeihliches Zusammenleben in einer vielfältigen, demokratischen Gesellschaft.
Gerade auch – und vielleicht besonders – im Umgang mit Menschen, die sich extremistisch, menschenfeindlich oder demokratiefeindlich äußern.
Dabei ist mir eines besonders wichtig: Das Ziel meines Dialogs ist nicht primär Veränderung.
Mein erstes Ziel ist Verstehen – und dem Gegenüber ein echtes Gefühl von Verstanden-Werden zu vermitteln.
Verstehen bedeutet dabei ausdrücklich nicht automatisch: zustimmen.
Ich kenne meine eigenen Positionen sehr genau – und vertrete sie klar. Gerade weil meine Haltung oft eine grundlegend andere ist, möchte ich verstehen, wie ein Mensch zu seiner Weltsicht kommt. Welche Erfahrungen, Ängste, Kränkungen oder Deutungsmuster dahinterstehen.
Nicht der Versuch zu überzeugen öffnet Veränderung – sondern das ehrliche Bemühen zu verstehen.
Verstehen als Voraussetzung für versöhnlichen Dialog
Ich begegne meinem Gegenüber mit aufrichtiger Neugier. Nicht taktisch, nicht manipulativ, nicht mit dem verdeckten Ziel, jemanden „zu drehen“.
Gerade diese Haltung macht versöhnlichen Dialog überhaupt erst möglich.
Ich frage nach – auch hartnäckig und konkret:
- Wie würde das aussehen, wenn wir diesen Lösungsweg wirklich gehen?
- Was würde das für andere Menschen bedeuten?
- Wer trägt die Konsequenzen?
Diese Fragen sind kein Angriff, sondern Teil ernst gemeinten Verstehens. Sie dienen der Klärung – als Beitrag zu einem gedeihlichen Zusammenleben, das Konflikte nicht vermeidet, sondern konstruktiv austrägt.
In meiner Arbeit als Konfliktmoderator und Mediator folge ich dabei einem einfachen, bewährten Grundsatz:
Erst verstehen, dann verstanden werden.
Dialog heißt nicht Einverständnis
Ich setze mich seit vielen Jahren praktisch und professionell für einen versöhnlichen Umgang mit gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit ein. Gemeinsam mit Mo Asumang habe ich einen Verein gegründet (www.mo-lab.org), der bundesweit Trainings anbietet. Ich führe diese Trainings selbst durch und bilde Trainer:innen aus.
Ich habe zahlreiche Gespräche auf der Straße geführt – in ganz Deutschland, mit Menschen unterschiedlichster Hintergründe und Überzeugungen. Und ich kann sagen: Diese Form des Dialogs trägt.
Nicht, weil sie Veränderung erzwingt, sondern weil sie Beziehung ermöglicht – und Beziehung ist eine zentrale Voraussetzung für jedes gedeihliche Zusammenleben.
Wenn wir Menschen hinter Mauern stecken, sehen wir nicht mehr, was dort passiert. Und wir nehmen ihnen – und uns – die Möglichkeit, dass Veränderung gesichtswahrend geschehen kann. Wir brauchen Brücken. Brücken, über die ein Mensch ohne Scham zurückkommen kann.
Der entscheidende Punkt: Kontext
Warum also wende ich unterschiedliche Dialogstrategien an?
Weil Kontext zählt.
Im persönlichen Kontakt
Als Mensch in der Familie, im Freundeskreis, im Verein, auf der Straße oder im direkten Eins-zu-Eins-Gespräch steht für mich der versöhnliche Dialog im Mittelpunkt. Ich höre zu, frage nach, widerspreche klar, aber respektvoll. Ziel ist nicht Überzeugung, sondern Verständigung – als Basis für ein gedeihliches Zusammenleben trotz tiefgreifender Unterschiede.
Im politischen Amt
Im Kommunalparlament gilt ein anderer Kontext.
Hier stehe ich nicht nur für mich, sondern auch für meine Freund:innen, Nachbar:innen und all jene, die von menschenfeindlicher Politik direkt betroffen wären.
Ich verweigere daher jede Form politischer Kooperation mit Vertreter:innen einer Partei, die sich in einer gesichert rechtsextremen Struktur wohlfühlt, die Menschen aus diesem Land „rauswerfen“ möchte und die regelmäßig durch rassistische, antisemitische, frauenfeindliche oder demokratiefeindliche Äußerungen auffällt.
Ein Handschlag ist hier nicht neutral – er signalisiert politische Zusammenarbeit.
Diese lehne ich ab.
Gleichzeitig begegne ich auch hier jedem Menschen mit dem Respekt, der ihm als Mensch zusteht:
- Ich grüße per Kopfnicken.
- Ich gehe sachlich auf inhaltliche Beiträge ein.
- Ich bleibe professionell und respektvoll.
Aber dabei bleibt es.
Warum ich im Kommunalparlament keinen Handschlag anbiete
Im politischen Raum haben Gesten Bedeutung.
Ein Handschlag ist nicht nur Höflichkeit – er signalisiert politische Normalität und Kooperationsbereitschaft.
Ich verweigere daher bewusst den Handschlag mit Vertreter:innen einer Partei, die sich in einer gesichert rechtsextremen Struktur wohlfühlt, die offen über „Remigration“ spricht und die einen Teil meiner Freund:innen, Nachbar:innen und Mitbürger:innen aus diesem Land ausschließen oder vertreiben möchte.
Diese Entscheidung richtet sich nicht gegen den Menschen, sondern gegen das politische Projekt, für das er steht.
Gleichzeitig gilt:
Ich begegne auch hier jedem Menschen mit dem Respekt, der ihm als Mensch zusteht.
Ich grüße per Kopfnicken, führe sachliche Debatten und gehe auf inhaltliche Beiträge ein.
Was ich verweigere, ist politische Normalisierung.
Nicht Respekt.
Zwischen Schwarz und Weiß gibt es viele Grautöne
Zwischen persönlichem Gespräch und parlamentarischer Auseinandersetzung liegen viele weitere Kontexte: Podiumsdiskussionen, öffentliche Veranstaltungen, Bildungsarbeit, Medienformate.
In jedem dieser Räume stelle ich mir dieselbe Frage neu:
Was dient hier dem versöhnlichen Dialog – und damit einem gedeihlichen Zusammenleben – am meisten?
Meine Überzeugung
Versöhnlicher Dialog ist kein Selbstzweck.
Er ist eine Haltung – und zugleich ein Werkzeug, das kontextabhängig eingesetzt werden muss.
Brücken bauen heißt nicht, Mauern zu ignorieren.
Es heißt, Wege zurück offen zu halten, ohne die eigenen Werte preiszugeben.
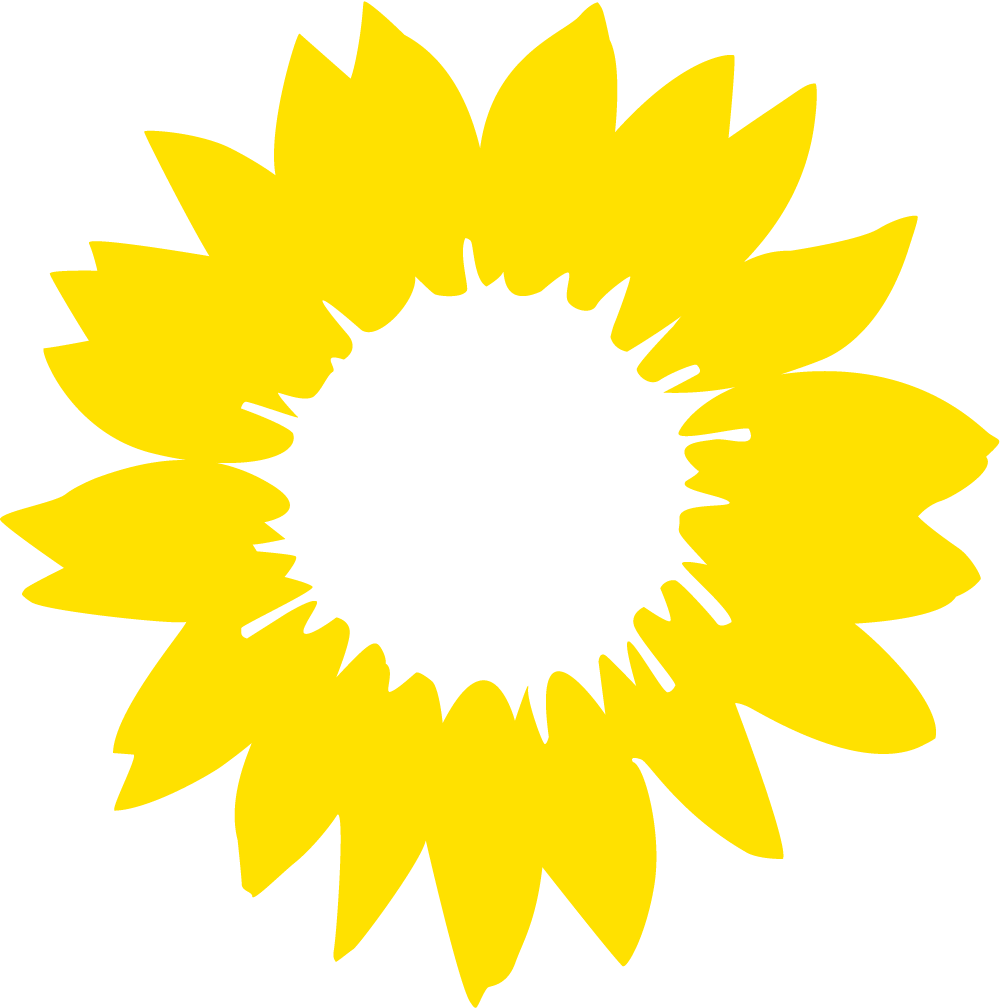



Artikel kommentieren